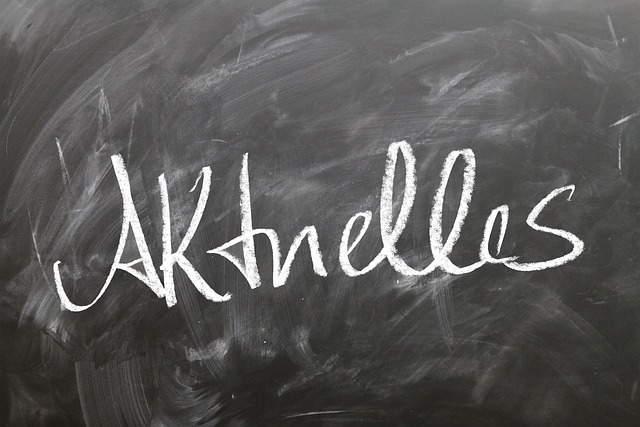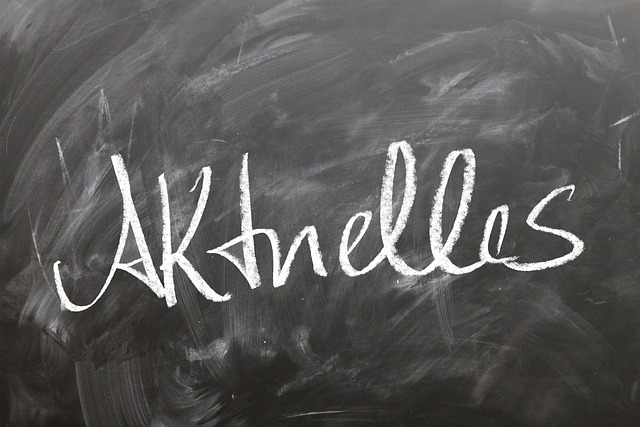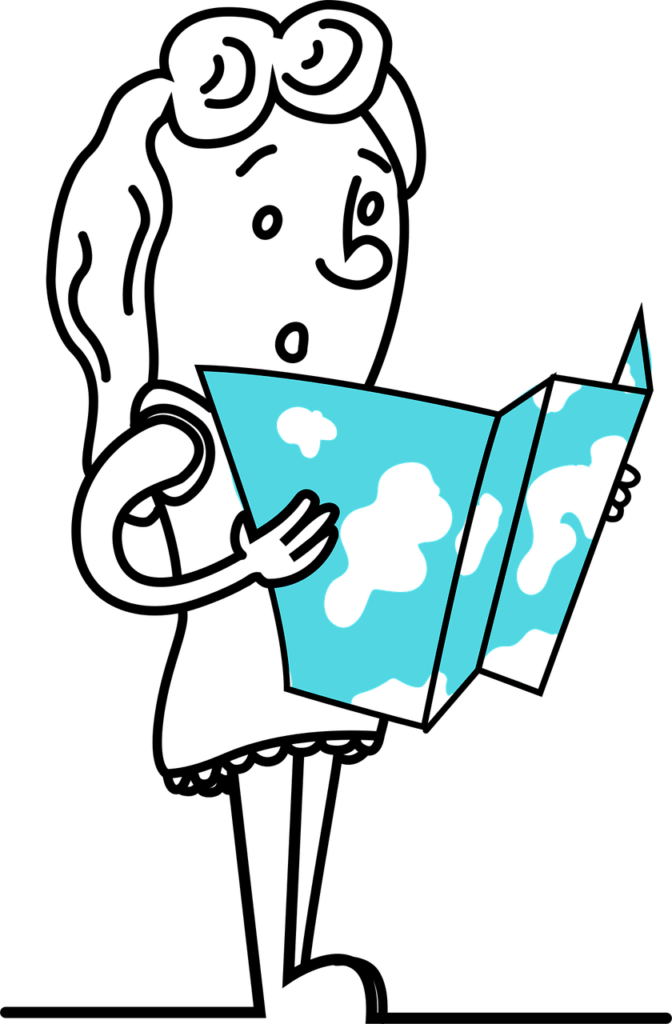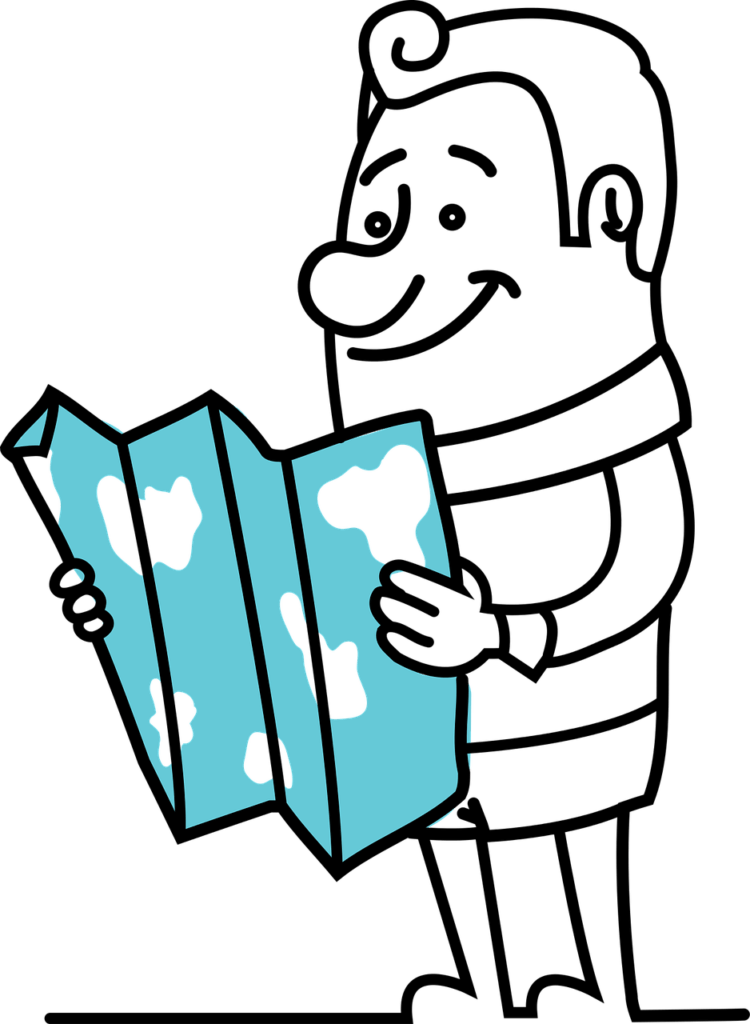Teil 3: Die Renaturierung des Polders Fuhlendorf
Dorfzeitung: Wie ist der Projektstand der Renaturierung des Polders Fuhlendorf?
Herr Groth: Zum Stand kann ich nicht so sehr viel sagen. Die Ostseestiftung hat gesagt, dass das Bauprojekt genehmigungsfähig ist und angefangen werden kann, wenn das Ja-Wort vom Staat, dem Geldgeber, kommt. Dazu müssen sie wahrscheinlich noch zwei, drei Gespräche mit den großen Landbesitzern führen.
1994, 1995 habe ich als erster gesagt, dass der Hochwasserschutz in Michaelsdorf in den Flächennutzungsplan mit aufgenommen werden muss. Das hat leider nicht geklappt, weil das Planungsbüro zur damaligen Zeit nicht in der Lage war, dies nach den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik durchzuführen. Daraufhin haben wir uns jemanden gesucht, der das schon gemacht hat. Wir haben den Hochwasserschutz in Michaelsdorf mit in den Flächennutzungsplan aufgenommen, damit die Behörden uns die Genehmigung für Bautätigkeiten erteilen. Davon ist das abhängig gewesen. Der größte Punkt dabei war die Abwassergeschichte. Wenn wir das Abwasser nicht regeln, werden wir keine Bautätigkeit mehr genehmigt bekommen. Daraufhin haben wir das alles ausgebaut.
Dann kam ein paar Jahre später die sogenannte Baltic-Geschichte mit den Windmühlen. Über eine Million sollte in die Renaturierung eingesetzt werden. Dazu haben wir zwei große Veranstaltungen mit den Landbesitzern gemacht, die das Projekt aber abgelehnt haben. Die Ostsee-Stiftung hat aber weitergearbeitet und es folgten noch zwei Veranstaltungen mit den Landbesitzern. Das Projekt wurde aber wieder durch einen Bauern, der dort Land hatte – kein Einwohner von hier – vehement abgelehnt. Dann hat die Ostsee-Stiftung mit meiner Hilfe angefangen, einzeln mit den Leuten zu sprechen. Meine Bedingung für diese Gespräche war: Einer Renaturierung ohne Hochwasserschutz für den Ort Michaelsdorf kann die Gemeinde nicht zustimmen. Das sehen zwar viele anders, mittlerweile habe ich ja gehört, dass ich gesagt haben soll, in 50 Jahren wird beim Hochwasserschutz noch nichts gemacht worden sein. Kursiert, aber ist mir egal.
Der von mir eingeladene damaligen Staatssekretär hat uns in der Gemeindevertretung erklärt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern augenblicklich noch gar nicht so weit ist, den Hochwasserschutz im Innenbereich zu realisieren. Der damalige Schwerpunkt war der Ostsee-Bereich. Mittlerweile gibt es wohl ein Projektmanagement, das auch die inneren Bereiche des Hochwasserschutzes mit ins Auge fasst. Ich habe immer mit den in unserer Verwaltung Barth zuständigen Leuten gesprochen, dass sie für die Gemeinden Pruchten, Fuhlendorf und Saal den Hochwasserschutz wie in Barth mit dem Deich organisieren sollen. Nichts. Null.
Jetzt obliegt die Renaturierung der Ostseestiftung und uns als Gemeinde. Die Mehrheit der Grundstücksbesitzer hat wohl zugestimmt. Sie müssen noch ein oder zwei Ausgleichsmaßnahmen beziehungsweise Austauschgrundstücke finden. Und wenn dort nicht jemand dabei ist, der nur seinen eigenen Vorteil sucht – das ist nicht der Bauer – dann glaube ich, kann das auch was werden. Aber immer im Zusammenhang, da lege ich viel Wert drauf, mit dem Hochwasserschutz Michaelsdorf. Und wie der Hochwasserschutz in Michaelsdorf aussehen könnte, haben sie auch vorgestellt. Richtig angeschoben wurde der Prozess wieder durch ein Petitionsschreiben einer Frau aus Michaelsdorf. Das zeigt also: Wenn die Bürger sich einbringen, dann kommt auch Bewegung in die Sache. Denn die Gemeinde ist für den Hochwasserschutz nicht zuständig.
Dorfzeitung: Was passiert mit dem Landeigentum, das die Ostseestiftung gekauft hat, wenn das Projekt der Renaturierung realisiert ist?
Herr Groth: Erstmal ist die Landgesellschaft Eigentümer, sie muss das Land dann bewirtschaften, so wie ein Landbesitzer das auch machen würde. Die Gemeinde ist im Prinzip raus, denn der Gemeinde gehört ja nichts. Sie muss nur zustimmen, ob eine Renaturierung stattfinden kann. Der Ostseestiftung obliegt es, mit den Landeigentümern eine Vereinbarung zu treffen, ob sie ihnen Austauschgrundstücke, Ausgleichszahlungen oder andere Varianten des Ausgleichs gibt. Die Austauschgrundstücke müssen nicht unbedingt in der Gegend liegen. Die Ostseestiftung wird die Ländereien nicht in Eigenregie bewirtschaften, sondern wird diese Bewirtschaftung den Bauern wieder übergeben. Nehmen wir z.B. den Schafbesitzer, der dann für die Landgesellschaft oder für die Ostseestiftung dieses Land bewirtschaftet, indem er in der möglichen Zeit seine Schafe da drauf bringt. Das heißt: Im Endeffekt entstehen da auch wieder Arbeiten für andere. Wie das aber genau organisiert wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Mit Sicherheit ist dabei viel zu beachten, auch, was unseren Horizont für Umweltschutz übersteigt. Ich kann nicht sagen, was eine Vernässung des Landgrundstückes dort für Vorteile oder für Nachteile hat. Ich sehe aber, wenn man z.B. nach Friesland fährt, wo das alles schon vor Jahren gemacht worden ist, dass auch diese Grundstücke wieder nutzbar sind.
Dorfzeitung: Wie nehmen Sie die Stimmung in der Gemeinde zu diesem Projekt der Renaturierung wahr?
Herr Groth: Es interessieren sich hauptsächlich die dafür, die dort auch Land besitzen. Dass es ein, zwei gibt, die darauf aufspringen wollen, weil sie ihre eigenen privaten Sachen geregelt haben wollen, ist auch bekannt. Ich brauche keinen Namen nennen, den wissen Sie. Und da gibt es die, die kaum Beziehungen haben zu ihrem Land. Die haben im Prinzip alle schon ja gesagt. Die Landbesitzer, die größere Ländereien haben, sind beim Überlegen und viele haben schon an die Landgesellschaft oder an die Ostseestiftung verkauft. Ein, zwei sind dabei, die noch überlegen und auch wissen, dass sie Nachteile davon haben. Sie schauen, wie sie aus den Nachteilen wenigstens eine schwarze Null für sich machen können. Und es mag ja immer noch einen geben, der dagegen ist. Aber das ist in der Sache immer so, dass es ein, zwei gibt, die das anders sehen und gar nichts machen wollen. Aber dass wir was für die Natur machen müssen, glaube ich, steht außer Frage. Man soll aber nicht in Hysterie verfallen dabei, sondern tatsächlich und vernünftig abarbeiten.
Fortsetzung folgt!